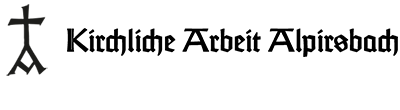Berichte zur Sommerwoche in Gernrode
46. Sommerwoche in Gernrode 2025
Auch wenn man jedes Jahr nach Gernrode fährt, ist nicht alles wie im Vorjahr. Wohl vertraut zwar empfangen einen Stiftskirche und Cyriakushaus, und sowohl der Heimleiter als auch alle bekannten Konventualen, die man nun wiedertrifft, lassen eine familiäre Atmosphäre entstehen. Dann werden gleich auch Fragen gestellt, ob der oder die in diesem Jahr auch kommt oder warum nicht. Und schon beginnt ein neues Abenteuer: diese eine Woche in der Gemeinschaft des Konvents, im Erarbeiten der gregorianischen Gesänge, im gemeinsamen Stundengebet, im Mitdenken bei den Studieneinheiten, im Erleben von Mahlzeiten, Ausflügen, Feiern, Gesprächen, Stille. Was für eine Woche!
Es waren drei neue Konventsmitglieder dabei, die immer mehr in die Gruppe fanden und sich wohlfühlten. Im Verlauf der Woche kamen auch „Nachzügler“ hinzu, so dass wir es in Vollständigkeit zu 29 Erwachsenen und 4 Kindern brachten.
Wir hatten eine neue Präses: Dorothea Gölz-Most hat dieses Amt mit großer Souveränität ausgefüllt; sie hatte es übernommen im Wissen um die Erkrankung ihres langjährigen Vorgängers Michael Müller. Wir gedachten seiner und aller Kranken in den Preces, ein Totengedenken war diesmal nicht vorgesehen. Dann aber erschütterte uns die Nachricht unserer langjährigen Konventualen Gabriele Müller; wir gedachten ihrer bei der Complet am Dienstag und am folgenden Tag in den Preces. So wurde die Woche etwas stiller als sonst. Und doch haben wir auch gefeiert am Mittwochabend und unseren Ausflug am Donnerstag zur Cyriakuskirche in Frose gemacht, in der Thomas Müntzer (+27.5.1525!) für kurze Zeit Propst gewesen ist.
Das Studium in dieser Woche leitete Prof. Dr. Günter Bader aus Gomadingen. Das Thema „Warum singen? Psalmen und Hymnen als unterschiedliche Antworten auf eine sehr einfache Frage“ war durchaus nicht einfach zu durchdringen, aber höchst faszinierend in seiner gedanklichen Tiefe. (s.a. Bericht von Elisabeth Dickmann!) Bewährt waren die Singübungen unter Leitung von Christine Unger mit den wie immer fröhlichen Einsingefiguren. Die Messe am Samstag wurde von Robert Grimmell zelebriert, die Predigt hielt Käthe Lange. Die Kollekte der Messe überstieg die 1400 Euro-Marke; abgesehen von einem kleinen Teil für die Ortsgemeinde gingen etwa 1.100 Euro als Spende an das Projekt „Lebenschance“ in Togo.
Als weitere besondere Dienste wären zu nennen: Walter J. Pehl als Homiliator und Alexander Beck als Pastor i.V. im Gemeindegottesdienst. Im Grunde aber haben alle Teilnehmenden in irgendeiner Form der Gemeinschaft gedient, und das macht diese so kostbar.
Dankbar haben wir uns am Ende der Woche voneinander verabschiedet, zum größten Teil mit einem „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr“. In allen aber werden wohl die gregorianischen Gesänge noch eine Weile nachklingen – und das tut so gut!
Käthe Lange
Gernrode 2025 – Bericht über das Studium mit dem Titel „Warum singen?“
Mit dieser Frage stiegen wir gleich tief ein in die Thematik Psalmen, Psalmlied und Hymnus, die uns Prof. Günter Bader mit sorgfältig und ausführlich vorbereiteten Textblättern und bildhaften Vorträgen nahebringen wollte. Die allgemeine natürliche Erfahrung des Singens bildete den Ausgangspunkt.
Der älteste bekannte christliche Hymnus stammt aus Griechenland und wird mit „heiteres Licht“ bezeichnet – die Erfahrung des Morgenlichts oder des ‚ex oriente lux‘, des Christuslichts. Die viel älteren Psalmen dienen der Anrufung für Schutz und Hilfe und dem Lobpreis Gottes und seiner Schöpfung. Ihr Gesang war im christlichen Gottesdienst in der reinen Form den Kanonikern vorbehalten, wie es in dem frühchristlichen regionalen Konzil von Lacodicea (4.Jh. p.c.) beschlossen wurde.
Dem steht das Psalmlied gegenüber, das vor allem in der reformatorischen Kirche auch als ‚Volkslied‘ verstanden werden kann, zumal es in der Volkssprache abgefasst wurde. Hier singt die Gemeinde, das Volk.
Jeder dieser Formen haftet eine eigene poetische Sprache an, die literaturwissenschaftlich als unterschiedliche Kategorien betrachtet werden müssen. Hymnen sind deutlich definiert durch das Metrum und die Melodieführung, die am Ende zu dem Erscheinen eines Gottesbildes führt. Augustinus bezeichnet in seinem Werk ‚De musica‘ das Singen selbst als Weg zur Gotteserkenntnis. Hymnen sind Lobgesänge mit Inbrunst vorgetragen und prächtig geschmückt. Psalmlieder sind poetische Kunstwerke, die den Psalmen inhaltlich nachempfunden werden in der jeweils aktuellen Zeitsprache, sie haben ein Metrum und meist einen Reim.
Was aber kennzeichnet die innere Ordnung der Psalmen? Auch sie haben eine poetische Struktur, die Strophenbildung und die Wiederholungen. Aber sie sind auch Theologie, Glaubensaussage und Gebet in einem. Die Ausgewogenheit des Textes entsteht durch die mehrfache Nennung des Gottesnamens, aber auch durch die Stille – das medium silentium - zwischen den Versen, besser: den Zeilen: Der Psalmenübersetzer Hiernonymus formulierte es so: ‚extra psalmi silentium‘. Außerhalb der Psalmen ist Schweigen. Das Schweigen ist die Erscheinung Gottes, es unterbricht nicht den Textvortrag, sondern die Psalmengesänge unterbrechen das Schweigen. Wem kommt da nicht die wunderbare Formulierung Gerhard Tersteegens in seinem Lied ‚Gott ist gegenwärtig‘ aus den Jahren 1727-1729 ins Gedächtnis?
Professor Bader scheute sich nicht, den mühseligen Forschungsweg durch die Urtexte, die griechischen und lateinischen Übersetzungen mit allen Zweifeln und Fragen vor uns offen zu legen. Das machte den Gang von außen nach innen, vom Allgemeinen zum Spezifischen und zur letztendlichen Bedeutung nachvollziehbar.
Die abschließende Betrachtung führte noch einmal zu der Frage, wie wir durch den Gesang zur Gotteserkenntnis gelangen können. Ob das Psalmensingen Bestand haben wird in unserer modernen Gottesdienstgestaltung, ob nicht Hymnus und Psalmlied (vor allem die reformatorischen Nachdichtungen) den Platz der Psalmen übernehmen werden, bleibt eine offene Frage.
Elisabeth Dickmann, 10.08.2025